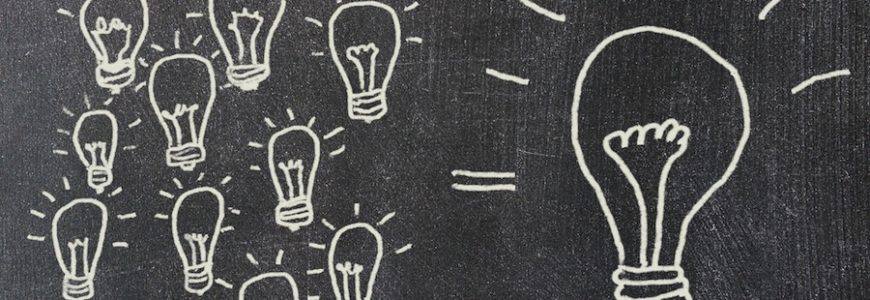Immer wieder taucht in Hausverwaltungen die Frage auf, was genau unter der Weiterbildungspflicht für Verwalter zu verstehen ist. Kurz gesagt, besteht diese Pflicht für gewerbliche Wohnimmobilienverwalter mit der Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung (GewO). Zudem gilt die Weiterbildungspflicht für die bei diesen Verwaltern beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirken. Konkret bedeutet die Weiterbildungspflicht, dass sich die Betroffenen fachlich entsprechend ihrer ausgeübten Tätigkeit weiterbilden müssen. Was Hausverwaltungen und interessierte Eigentümer zur Weiterbildungspflicht des Verwalters wissen sollten, erfahren Sie hier.
1. Weiterbildungspflicht: Das folgt aus der Rechtsgrundlage
2. Wer von der Weiterbildungspflicht betroffen ist
3. Weiterbildungspflicht seit dem 01.08.2018 innerhalb von drei Kalenderjahren für 20 Zeitstunden
3.1. Dreijähriger Weiterbildungszyklus (einschließlich Arbeitgeberwechsel)
3.2. Umfang von 20 Zeitstunden
3.3. Was für Immobilienkaufleute / Geprüfte Immobilienfachwirte gilt
3.4. Besondere Regeln für Elternzeitnehmer
4. So sieht die Weiterbildungspflicht aus
4.1. Arten von Weiterbildungsmaßnahmen
4.2. Inhalte der Weiterbildung
5. Wie die Weiterbildung den Behörden nachzuweisen ist
6. Diese Informationspflichten bestehen gegenüber Auftraggebern
1. Weiterbildungspflicht: Das folgt aus der Rechtsgrundlage
Geregelt ist die Weiterbildungspflicht in § 34c Absatz 2a GewO i. V. m. § 15b und den Anlagen 1 bis 3 Makler- und Bauträgerverordnung(MaBV). Nach dieser Rechtsgrundlage besteht für
- gewerbliche Wohnimmobilienverwalter (und Immobilienmakler) mit der Erlaubnis nach 34c GewO sowie
- ihre unmittelbar bei der jeweils erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkenden beschäftigten Personen
- seit dem 08.2018 innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren
- in einem Umfang von 20 Zeitstunden (jeweils 60 Minuten die Stunde, wobei in dem Fall, in dem der Verwalter zugleich Makler ist, die 20 Zeitstunden für jeden der beiden Bereiche anfallen)
- eine Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung
2. Wer von der Weiterbildungspflicht betroffen ist
Zur Weiterbildung verpflichtet sind neben dem Wohnimmobilienverwalter die unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkenden Beschäftigten.
2.1. Wohnimmobilienverwalter
Ist der Verwalter Betreiber der Hausverwaltung und führt damit ein Einzelunternehmen als Unternehmer, ist er zugleich Inhaber der Erlaubnis nach § 34c GewO und daher weiterbildungsverpflichtet. Hausverwaltungen werden jedoch häufig in unterschiedlichen Rechtsformen betrieben, etwa in Form einer GmbH. Zur Weiterbildung verpflichtet ist hier regelmäßig diejenige Person, die die Hausverwaltung gesetzlich vertritt.
Allerdings genügt es nach § 34c Abs. 2a Satz 3 GewO, wenn der Weiterbildungsnachweis durch eine angemessene Zahl von beim Gewerbetreibenden beschäftigten natürlichen Personen erbracht wird, die aufsichts- und vertretungsberechtigt sind. In diesem Fall dürfen die nicht weitergebildeten gesetzlichen Vertreter selbst keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten ausüben. Auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsstelle ist das durch einen Gesellschafterbeschluss oder Geschäftsführervertrag nachzuweisen.
Der Geschäftsführer einer GmbH, der Gesellschafter einer OHG oder der Komplementär einer KG darf daher von einer Weiterbildungsdelegation auf seine Mitarbeiter Gebrauch machen, wenn er
- selbst keine erlaubnispflichtige Tätigkeit ausübt, da er ausschließlich mit der Leitung und Organisation der Hausverwaltung befasst ist
- der nachgeordnete Mitarbeiter gegenüber denjenigen Mitarbeitern, die die erlaubnispflichtige Tätigkeit verrichten, weisungsbefugt Das ist etwa der Fall bei Abteilungsleitern, Bereichsleitern oder Leitern von Zweigstellen. Maßgeblich ist also nicht allein die gesetzliche Vertretungsmacht, sondern es kommt auch eine rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsbefugnis in Betracht
Ob die Tätigkeit als Verwalter tatsächlich ausgeübt wird, spielt für die Weiterbildungspflicht keine Rolle. Denn diese Pflicht knüpft an das Bestehen der jeweiligen Erlaubnis an. Handelt es sich um eine sogenannte Schubladenerlaubnis, etwa weil derzeit keine Hausverwaltung betrieben wird, besteht für den Erlaubnisinhaber trotzdem eine Weiterbildungspflicht.
2.2. Mitwirkende Beschäftigte
Unmittelbar bei der jeweils erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende beschäftigte Personen – und damit weiterbildungspflichtig – sind diejenigen Mitarbeiter, die typische Tätigkeiten einer Hausverwaltung ausüben. Dazu gehören etwa auf dem Gebiet der
- Wohnungseigentumsverwaltung die Erstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabrechnungen, die Einberufung und Durchführung von Eigentümerversammlungen sowie die Organisation und Überwachung von Erhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung von Mietobjekten über Wohnraum die Erstellung von Betriebskostenabrechnungen oder die Vermietung von Wohnungen bzw. Häusern
Keine Weiterbildungspflicht besteht für solche Mitarbeiter, die nicht an der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirken, weil sie innerbetriebliche, administrative Arbeiten verrichten. Das gilt vor allem für Mitarbeiter in den Bereichen Sekretariat, Buchhaltung und Personalwesen.
Für die Weiterbildungspflicht ist allein die Tätigkeit entscheidend. Auf die Verantwortlichkeit kommt es nicht an. So ist etwa der Sachbearbeiter,der eine Abrechnung lediglich entwirft, genauso weiterbildungspflichtig wie der ihm vorgesetzte Verwalter, der für die Richtigkeit der Abrechnung einstehen muss.
Da allein die Tätigkeit maßgeblich ist, unterfallen auch Teilzeitkräfte und Mini-Jobber der Weiterbildungspflicht, sofern sie erlaubnispflichtige Tätigkeiten ausüben.
Fraglich ist, was für die freien Mitarbeiter einer Hausverwaltung gilt, da vom Wortlaut des § 34c Abs. 2a GewO nur „beschäftigte“ Personen umfasst sind. Regelmäßig bedeutet ein Beschäftigungsverhältnis eine nicht selbstständige Tätigkeit, insbesondere im Sozialversicherungsrecht. Anders ist es jedoch im Arbeitsrecht, wo unter „Beschäftigung“ die Zuweisung von Arbeitsaufgaben durch den Arbeitgeber bzw. die Annahme der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung verstanden wird. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten die freien Mitarbeiter einer Hausverwaltung der Weiterbildungspflicht unterzogen werden, soweit sie erlaubnispflichtige Tätigkeiten verrichten.
3. Weiterbildungspflicht seit dem 01.08.2018 innerhalb von drei Kalenderjahren für 20 Zeitstunden
Seit dem Inkrafttreten der maßgeblichen Vorschriften der GewO und der MaBV am 01.08.2018 besteht die Weiterbildungspflicht für Immobilienverwalter und dort mitwirkende Beschäftigte. Dabei muss die Weiterbildung innerhalb von drei Kalenderjahren für 20 Zeitstunden erfolgen.
3.1. Dreijähriger Weiterbildungszyklus (einschließlich Arbeitgeberwechsel)
Nach dem Gesetzeswortlaut muss die Weiterbildung innerhalb von drei Jahren stattfinden, wobei auf Kalenderjahre abgestellt wird, § 34c Abs. 2a Satz 1 GewO. Damit beginnt der dreijährige Weiterbildungszyklus stets am 01.01. des Jahres der Beschäftigungsaufnahme, und zwar auch bei einem unterjährigen Beschäftigungsbeginn, also etwa mitten innerhalb oder gegen Ende des Kalenderjahres.
Nimmt also ein mitwirkender Beschäftigter am 01.06.2025 seine Tätigkeit neu auf und war zuvor noch nicht im Bereich einer Hausverwaltung tätig, beginnt seine Weiterbildungspflicht am 01.01.2025 und erstreckt sich auf die Jahre 2025, 2026 und 2027. Ab dem 01.01.2028 beginnt dann der nächste dreijährige Weiterbildungszyklus.
War der Beschäftigte dagegen zuvor bei einer anderen Hausverwaltung eingestellt und wechselt nun seinen Arbeitgeber, läuft für den Beschäftigten der dreijährige Weiterbildungszeitraum weiter. Die bei seinem früheren Arbeitgeber wahrgenommenen Weiterbildungsstunden kann der Beschäftigte zum neuen Arbeitgeber „mitnehmen“. Das trifft ebenso bei einem Geschäftsführerwechsel zu. Der vorherige Arbeitgebermuss an den Beschäftigten die vorhandenen Weiterbildungsbescheinigen herausgeben, der diese seinerseits dem neuen Arbeitgeber zu überlassen hat. Die Bescheinigungen sollte der frühere Arbeitgeber kopieren, um gegebenenfalls die erfolgte Weiterbildung des bereits ausgeschiedenen Beschäftigten darstellen und belegen zu können.
3.2. Umfang von 20 Zeitstunden
Der Umfang der Weiterbildung beträgt 20 Stunden innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren, wobei es sich um volle Zeitstunden handelt. Da für diese 20 Stunden der Drei-Jahres-Zeitraum maßgeblich ist, ist es allein Sache des Betroffenen, wann er der Weiterbildungspflicht nachkommt. So können etwa zwischen zwei Weiterbildungen über jeweils 20 Stunden mehr als fünf Jahre liegen, wenn der Betroffene jeweils zum Anfang des ersten Drei-Jahres-Zeitraums an 20 Stunden und zum Ende des zweiten Drei-Jahres-Zeitraums wiederum an 20 Stunden Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt.
Demgegenüber kann der Betroffenen aber die über 20 Stunden hinausgehende Weiterbildung aus einem Drei-Jahres-Zeitraum nicht auf den nachfolgenden Drei-Jahres-Zeitraum „mitnehmen“ und auf die 20 Stunden des folgenden Zeitraums anrechnen. Vielmehr sind im nachfolgenden Drei-Jahres-Zeitraum erneut volle 20 Stunden Weiterbildung zu absolvieren.
3.3. Was für Immobilienkaufleute / Geprüfte Immobilienfachwirte gilt
Wird ein Ausbildungsabschluss als Immobilienkaufmann bzw. Immobilienkauffrau oder eines Weiterbildungsabschlusses als Geprüfter Immobilienfachwirt bzw. Geprüfte Immobilienfachwirtin erworben, gilt das als Weiterbildung, § 15b Abs. 1 Satz 6 MaBV. Darüber hinaus besteht die (erneute) Pflicht zur Weiterbildung drei Jahre nach Erwerb des Ausbildungs- oder Weiterbildungsabschlusses, § 15b Abs. 4 MaBV.
Wurde also etwa im Jahr 2023 eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann begonnen, die im Jahr 2025 mit der bestandenen Abschlussprüfungendet, ist in den Jahren 2023, 2024 und 2025 die Weiterbildungspflicht erfüllt. Die darauffolgenden drei Jahre 2026, 2027 und 2028 sind weiterbildungsfrei. Eine Pflicht zur Weiterbildung besteht erst wieder ab dem Jahr 2029.
Wird die Ausbildung abgebrochen oder nicht bestanden, gilt für die Zeit der Ausbildung keine Weiterbildungspflicht. Im Jahr nach dem Abbruch oder des Nichtbestehens muss sich der Betroffene jedoch wieder weiterbilden. Der Betroffene ist also – anders als beim Erwerb des Ausbildungsabschlusses – nicht für drei Jahre nach der Ausbildung von der Weiterbildung befreit.
3.4. Besondere Regeln für Elternzeitnehmer
Arbeitnehmer können bis zu drei Jahren Elternzeit in Anspruch nehmen, § 15 Abs. 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Dabei darf die Elternzeit auch aufgeteilt werden. Fallen nun Elternzeit und Wegfall der Ausübung einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit zusammen in einen dreijährigen Weiterbildungszyklus, besteht keine Weiterbildungspflicht.
Fallen dagegen Elternzeit und Wegfall der Ausübung einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit nicht zusammen in einen dreijährigen Weiterbildungszyklus, muss der Elternzeitnehmer jeweils die Weiterbildung für die von der Ausübung einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit betroffenen Zyklen über die vollen 20 Stunden absolvieren. Das gilt ebenso bei einer Aufteilung der Elternzeit.
4. So sieht die Weiterbildungspflicht aus
Bestimmte Arten von Weiterbildungsmaßnahmen sind möglich, wobei deren Inhalte vorgeschrieben sind.
4.1. Arten von Weiterbildungsmaßnahmen
Als Arten von Weiterbildungsmaßnahmen werden in § 15b Abs. 1 Satz 3 MaBV ausdrücklich folgende Möglichkeiten genannt:
- Präsenzform
- Begleitetes Selbststudium
- Betriebsinterne Weiterbildungsbildungsmaßnahmen
Weiterbildungsmaßnahmen in Präsenzform sind etwa Tagungsveranstaltungen, Seminare, Vorträge und Online-Seminare mit Präsenzkontrolle.
Beim begleiteten Selbststudium ist vor allem an Webinare zu denken. Wichtig dabei ist, dass durch den Veranstalter eine Lernerfolgskontrolle erfolgt, da andernfalls die Weiterbildung nicht anerkannt wird.
Für betriebsinterne Maßnahmen kommt in erster Linie die Hinzuziehung von externen Referenten in Betracht, aber auch die Beauftragung betriebsinterner Referenten. Maßgeblich ist, dass die Anforderungen der Anlage 2 zu § 15b MaBV erfüllt werden, also der Weiterbildungsmaßnahme eine Planung zugrunde liegt, die Maßnahme systematisch organisiert wird und die Qualität derjenigen sichergestellt ist, die die Weiterbildung durchführen. Gemeint sind damit das erforderliche Fachwissen und die Kompetenz des Referenten.
Es gibt für keine Weiterbildungsmaßnahme, gleich welcher Art, eine Zertifizierung oder eine staatliche Anerkennung von Anbietern. Ob die Maßnahme anerkannt wird, entscheidet der zuständige Sachbearbeiter der für die Erlaubniserteilung nach § 34c GewO zuständigen Behörde. Maßgebliches Kriterium ist, ob die Vorgaben der Anlage 2 zu § 15b MaBV eingehalten wurden.
4.2. Inhalte der Weiterbildung
Die Weiterbildungsinhalte richten sich nach der Anlage 1 Buchstabe B zu § 15b Abs. 1 MaBV. Vorgesehene Inhalte für Wohnimmobilienverwalter sind Grundlagen der Immobilienwirtschaft, rechtliche und kaufmännische Grundlagen, Verwaltung von Wohnungseigentumsobjekten und Mietobjekten, technische Grundlagen der Immobilienverwaltung, Wettbewerbsrecht sowie Grundlagen des Verbraucher- und Datenschutzes. Aufgrund des enormen Umfangs dieser Weiterbildungsinhalte reicht es aus, wenn Betroffene sich auf bestimmte Weiterbildungsthemen nach ihrer freien Wahl konzentrieren.
5. Wie die Weiterbildung den Behörden nachzuweisen ist
Die Hausverwaltung hat zunächst lediglich die Pflicht, die Weiterbildungsbescheinigungen des Verwalters und den mitwirkend Beschäftigten zu sammeln und aufzubewahren. Die Aufbewahrung hat auf einem dauerhaftem Datenträger in den Geschäftsräumen der Hausverwaltung zu erfolgen, also etwa auf Papier, CD-ROMs, USB-Sticks oder Computerfestplatten. Dabei gilt die Aufbewahrungspflicht für fünf Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt jeweils am Ende des Kalenderjahres, in dem die Weiterbildung erfolgt ist, § 15b Abs. 2 Satz 3 und 4 MaBV.
Weiterbildungsbescheinigungen müssen stets folgende Angaben enthalten, deren Vorhandensein die Hausverwaltungen überprüfen sollten:
- Weiterbildungsumfang in Zeitstunden
- Vor- und Nachname des Teilnehmers
- Datum der Weiterbildungsmaßnahme
- Inhalte der Weiterbildungsmaßnahme
- Adresse und Kontaktdaten des Weiterbildungsanbieters
Die für die Erlaubniserteilung nach § 34c GewO zuständige Behörde kann anordnen, dass die Hausverwaltung eine unentgeltliche Erklärungüber die vom Verwalter und den weiterbildungsverpflichteten Mitarbeitern absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen abzugeben hat, § 15 Abs. 3 Satz 1 MaBV. Die Erklärung hat dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 3 zur MaBV zu entsprechen und die Erfüllung der Weiterbildungspflicht in den letzten drei Kalenderjahren zu dokumentieren. Die Erklärung darf elektronisch erfolgen, also etwa per E-Mail.
Ein Bußgeld in Höhe von jeweils bis zu 5.000 Euro droht, wenn die Aufbewahrungsfrist nicht beachtet oder der behördlichen Anordnung zur Abgabe der Weiterbildungsbescheinigungen nicht nachgekommen wird, § 18 Abs. 1 Nr. 9, 10 MaBV i. V. m. § 144 Abs. 2 Nr. 6 GewO.
6. Diese Informationspflichten bestehen gegenüber Auftraggebern
Hausverwaltungen müssen auf Anfrage ihres Auftraggebers unverzüglich Angaben über berufsspezifische Qualifikationen und die in den letzten drei Jahren absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen des Verwalters und diejenigen der mitwirkenden Beschäftigten erteilen, § 11 Satz 1 Nr. 3 MaBV. Das kann in Textform geschehen, also etwa per E-Mail. Damit soll Auftraggebern ermöglicht werden, sich ein Bild darüber zu machen, ob den Weiterbildungspflichten entsprochen wird.
Diese Angaben können auf der Internetseite der Hausverwaltung erfolgen, § 11 Satz 2 MaBV. Davon sollte Gebrauch gemacht werden. Denn so können etwa Wohnungseigentümer bei passender Gelegenheit, etwa der Einladung zu einer Eigentümerversammlung, darauf hingewiesen werden, dass die Angaben über die Qualifikation und Fortbildung des Verwalters und seiner Mitarbeiter auf dem Interauftritt der Hausverwaltung eingesehen werden können.
Angebote von Hausverwaltungen vergleichen - kostenlos und unverbindlich
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl von Hausverwaltungen die zu Ihrer Immobilie passen. Vertrauen Sie auf unserer Erfahrung bei der Auswahl von guten und passenden Hausverwaltungen und vergleichen Sie mehrere Angebote mit nur einer Anfrage.
 Hausverwalter-Angebote.de
Hausverwalter-Angebote.de